 DXer und DXing
DXer und DXingDer SINPO - Code
Empfangsbericht
QSL - Karten
Weltzeit
 DXer und DXing
DXer und DXing
Der SINPO - Code
Empfangsbericht
QSL - Karten
Weltzeit
Für viele mag es ein Rätsel sein, wie es möglich ist, dass uns Radiowellen von den entferntesten Orten der Welt erreichen können. Wie schaffen es die Kurzwellen, Tausende von Kilometern zu überbrücken?
Um das zu erklären, muss man einen Blick zum Himmel werfen. Die Erde ist von der Atmosphäre umhüllt, die aus mehreren Schichten besteht. Die für Kurzwellenhörer interessante Schicht ist die Ionosphäre, die in etwa 50 bis 100 Kilometer Höhe beginnt. Die Ionosphäre besteht aus ionisierten Luftteilchen, durch die Einstrahlung der Sonne werden die Luftmoleküle bewegt. Die dabei entstehenden freien Elektronen schwirren in der Schicht umher. Der Kurzwellenfunk macht sich den Effekt zunutze, dass die Funkwellen unter bestimmten Bedingungen an dieser Ionosphärenschicht gebrochen bzw. reflektiert werden, ähnlich wie bei einem Spiegel. Die Antenne des Senders strahlt die Funkwellen in einem bestimmten Winkel zur Erde in Richtung Himmel ab. An der Ionosphäre werden die sogenannten Raumwellen reflektiert und wieder zur Erde geschickt, wo sie tausend oder zweitausend Kilometer entfernt vom Senderort wieder auf die Erde auftreffen. Dort kann man dann die Sendungen empfangen. Die Funkwellen werden aber auch wieder von der Erde abgelenkt und können Sprünge von drei- bis viertausend Kilometer machen. So werden große Entfernungen rund um den Globus überbrückt. Außer der Raumwelle vom Sender strahlt dieser auch eine Bodenwelle aus, die sich parallel zur Erdoberfläche ausbreitet. Die Reichweite der Bodenwelle hängt von der Frequenz und der Beschaffenheit der Erdoberfläche ab - je mehr Berge, desto schlechter. Bei der Kurzwellenausbreitung nimmt man den Bereich in dem die Bodenwelle nicht mehr und die Raumwelle noch nicht empfangen werden nennt man "tote Zone". So ist eine Kurzwellenstation mit der Bodenwelle etwa in einem Umkreis von 50 Kilometer zu hören, und dann vielleicht wieder in 100 Kilometer Entfernung, wenn die Raumwelle die erste Reflektion an der Ionosphäre hinter sich hat und wieder auf den Boden trifft.
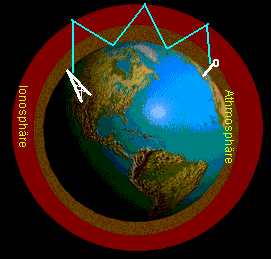 Weitere Eigenheiten der Kurzwellenausbreitung lassen sich aus der Beschaffenheit der Ionosphäre erklären. Sie besteht nämlich aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften. Mit Ausnahme der F2-Schicht sind diese sehr stark vom Sonnenstand abhängig. Wenn die Sonne untergeht, verschwinden diese Schichten schnell. In der Nacht bleibt nur noch die F2-Schicht. An dieser Schicht werden die Funkwellen reflektiert was man sich aber eher wie ein langsames Biegen vorzustellen hat. Bei dieser Reflektion verlieren die Wellen an Energie, werden also gedämpft. Diese Dämpfung ist aber in den Schichten D und E, die unterhalb der F2-Schicht liegen, noch größer. Sie steigt im Quadrat der Wellenlänge, d.h. Funkwellen mit niedriger Frequenz werden stärker gedämpft als Hochfrequenzwellen. Das erklärt, warum tagsüber kein richtiger Fernempfang auf den unteren Wellenbereichen, also unterhalb von 10 Megahertz möglich ist, sondern nur auf den höher frequenten Bändern. Nachts, wenn die D- und E-Schichten nicht mehr vorhanden sind, und damit auch die Dämpfung dort wegfällt, sind dagegen auch unterhalb von 10 Megahertz Sender aus großen Entfernungen hörbar - wie z.B. Tropenbandsender aus Südamerika. Daraus erklärt sich, warum in weit entfernten Zielgebiete tagsüber auf höheren Frequenzen gesendet wird und abends und nachts auf den niedrigen Frequenzen.
Weitere Eigenheiten der Kurzwellenausbreitung lassen sich aus der Beschaffenheit der Ionosphäre erklären. Sie besteht nämlich aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften. Mit Ausnahme der F2-Schicht sind diese sehr stark vom Sonnenstand abhängig. Wenn die Sonne untergeht, verschwinden diese Schichten schnell. In der Nacht bleibt nur noch die F2-Schicht. An dieser Schicht werden die Funkwellen reflektiert was man sich aber eher wie ein langsames Biegen vorzustellen hat. Bei dieser Reflektion verlieren die Wellen an Energie, werden also gedämpft. Diese Dämpfung ist aber in den Schichten D und E, die unterhalb der F2-Schicht liegen, noch größer. Sie steigt im Quadrat der Wellenlänge, d.h. Funkwellen mit niedriger Frequenz werden stärker gedämpft als Hochfrequenzwellen. Das erklärt, warum tagsüber kein richtiger Fernempfang auf den unteren Wellenbereichen, also unterhalb von 10 Megahertz möglich ist, sondern nur auf den höher frequenten Bändern. Nachts, wenn die D- und E-Schichten nicht mehr vorhanden sind, und damit auch die Dämpfung dort wegfällt, sind dagegen auch unterhalb von 10 Megahertz Sender aus großen Entfernungen hörbar - wie z.B. Tropenbandsender aus Südamerika. Daraus erklärt sich, warum in weit entfernten Zielgebiete tagsüber auf höheren Frequenzen gesendet wird und abends und nachts auf den niedrigen Frequenzen.
Man könnte aber jetzt daraus schließen, dass es für die Rundfunkstationen günstig wäre, nur auf den höheren Frequenzen zu senden, um in aller Welt gut anzukommen. Da spielt aber die Ionosphäre nicht mit! Je höher die Frequenz einer Funkwelle ist, um so stärker muss auch die Elektronendichte in der F2-Schicht sein, damit es überhaupt zu der gewünschten Reflexion kommt. Die Elektronendichte ist aber abhängig von der Sonnenaktivität. So ist während der Zeit eines Sonnenfleckenminimums eine Reflexion von Frequenzen oberhalb von 20 Megahertz kaum möglich. Je mehr Sonnenflecken, desto größer die Energieabstrahlung der Sonne, je besser die Reflexionseigenschaften der Ionosphäre und desto besser die Ausbreitungsbedingungen für die Kurzwelle. Die Sonnenfleckenaktivität unterliegt dabei einem 11Jahres-Zyklus, der mit einem Sonnenfleckenminimum beginnt. Es folgt dann in der Regel in den darauffolgenden 4 Jahren ein steiler Sonnenfleckenanstieg und nach dem Erreichen eines Maximums ein allmählicher Rückgang von fast 7 Jahren.
Die Bezeichnung "DX" kommt aus dem Sprachgebrauch der Amateurfunker. Das "D" beim "DX" steht für Distanz (Entfernung) und das "X" ist der mathematische Ausdruck für eine unbekannte. Hört man also ein Signal im Radio, weiß man zunächst nicht, von wo das Signal kommt - also ist die Entfernung erst einmal nicht bekannt. Hört man dem Programm aufmerksam zu, kann man an der Ansage hören, um welchen Sender es sich handelt.
Dabei kann es sich um solche oder ähnliche Ansagen handeln:
"Hier ist Radio Japan - NHK World" / "Ici la Voix de Sahel" / "This News comes to you from Radio Australia"
um nur einige Beispiele zu nennen. (vgl. auch meine Hörbeispiele auf den Seiten 20 - 26 )
Nachdem wir nun wissen, welches Programm wir gerade empfangen, lässt sich anhand der Weltkarte und eines Lineals leicht errechnen, welche Entfernung das Signal überbrückt hat.
Die engagierten Kurzwellenhörer nennen sich DXer, da sie meist auf der Suche nach neuen Sendern aus aller Welt sind. Je weiter und schwächer ein Signal zu hören ist, desto besser.
Es gibt auch DX-Clubs - Vereine - in denen sich Hobbyfreunde zum Gedankenaustausch zusammengeschlossen haben. (siehe meine Link-Liste - wo man nähere Infos anfordern kann)
Ein sogenannter Empfangsbericht dient in der Regel nur dazu, dem Sender zu beweisen, dass man ihn auch tatsächlich gehört hat. In seltenen Fällen sind die Radiostationen an aktuellen Empfangsmöglichkeiten interessiert. Ich sehe es eher als eine Gefälligkeit des Senders an, eine Bestätigungskarte auszufüllen - hat doch der Sender damit nur zusätzlich Arbeit, kostet Porto und dient allenfalls dazu die Posteingangsstatistik zu erhöhen.
Angenommen, Sie wollen einen Empfangsbericht verfassen, dann wollen Sie auch wissen, wie man einen solchen schreibt.
Ein Empfangsbericht sollte folgende Angaben enthalten:
Absenderangabe mit genauer Adresse, die Bezeichnung des gehörten Senders
Datum und Uhrzeit des Empfangs / Der Bericht sollte in der Regel über einen Zeitraum von 15 - 30 Minuten eine Aussage machen.
Empfangsfrequenzen: nach Möglichkeit in Kilohertz oder Meterband
Empfangsqualität mit dem SINPO - Code
Programmdetails / Art des Empfängers und der Antenne
sowie dem Hinweis ob eine QSL-Karte erwünscht ist.
Stellungnahmen zum Programm, Fragen an den Sender schreibe ich immer auf ein gesondertes Blatt.
Zweckmäßig für einen Empfangsbericht ist ein geeignetes Formular, das man sich mit einem Textverarbeitungsprogramm selbst erstellen kann - bzw. man greift auf Clubangebote zurück.
Mein Formular sieht sieht so aus:
| E M P F A N G S B E R I C H T / R E C E P T I O N R E P O R T |
|
| Radio Korea International Yoido-dong, Youngdungpo-gu 150-790 Seoul K O R E A |
Hörer / Listener Willi Stengel xxxxxxxxxx 7xxxxxxxxxxx G E R M A N Y |
| Datum / Date |
Zeit Time (UTC) |
Frequenz / Frequency kHz | S I N P O |
| 01.03.2001 | 20:00 - 21:00 |
3980 |
5 5 5 4 5 |
| Programmdetails: Hunderttausende Koreaner nahmen an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teil. 20:15 Uhr UTC: Kreuz und quer durch Korea mit Frau Chon Bericht über Beliebtheit von Risikokapitalunternehmen bei den Koreaner; Sprichwörterecke: Jeder Läufer hat auch einen Flieger über sich 20:31 Uhr UTC: Sondersendung anlässlich der Unabhängigkeitsbewegung vom 01. März 1919 gegen die Japaner |
| Empfänger / Antenne(n) AOR AR 7030 / Kenwood R-2000 10 m Langdraht mit Balun |
Ihr kurzweiliges informatives Programm hat mir sehr gut gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Empfangsbericht mit Ihrer neuen QSL-Karte bestätigen würden. Viele Grüsse aus Karlruhe |
Eine freundliche Gepflogenheit der Kurzwellensender besteht darin, Empfangsberichte mit hübschen Bestätigungskarten zu beantworten. Diese QSL - Karten aus aller Welt sind oft heißgeliebte Trophäen und Schmuckstücke eines Kurzwellenhörers. Mit diesen Karten kann er ja anschaulich beweisen, welche Radiostationen er aus allen möglichen Ländern schon gehört hat. Um solche QSL - Karten zu bekommen, maß man allerdings auch einen "Empfangsbericht" schreiben und natürlich auch via FAX, Email oder Brief verschicken
erlaubt eine einfache Empfangsbeurteilung von Kurzwellensendungen. Das Beurteilungsschema besteht aus 5 Kriterien mit jeweils 5 Qualitätsstufen.
| Stufe |
S Signalstärke |
I Interferenz |
N Nebengeräusche |
P Ausbreitungsstörungen |
O Gesamtbewertung |
| 5 | sehr stark | keine | keine | keine | sehr gut |
| 4 | stark | gering | gering | gering | gut |
| 3 | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
| 2 | schwach | stark | stark | stark | schlecht |
| 1 | sehr schwach | sehr stark | sehr stark | sehr stark | unbrauchbar |
Signalstärke: Als Maßstab dient hier ein Lokalsender der mit großer Signalstärke einfällt. Das entspricht S=5. Bei S=1 kann man nur noch erkennen, dass ein Sender da ist. Bei S=2 kann man noch unterscheiden ob gerade Musik oder Sprache gesendet wird. Bei S=3 kann man trotz Störungen noch brauchbar die Sendungen verfolgen. S=4 bedeutet ein stark einfallendes Rundfunksignal das kaum gestört wird.
Interferenz: damit versteht man Störungen die durch andere Sender verursacht werden und den Empfang mehr oder weniger beeinträchtigen. Bei dem Wert I=5 keine Störsignale bei I=1 sind die Störsignale so stark, dass die eigentliche Sendung kaum noch zu hören ist.
Nebengeräusche: Alle Störungen die ihren Ursprung in natürlichen Ursachen haben (z.B. Gewitter) werden hier erfasst. Die Bewertung ist gleich der der Interferenz.
P Ausbreitungsstörungen: darunter fallen hauptsächlich Signalschwunderscheinungen (Fading) , d.h. die Signalstärke pendelt zwischen stark und schwach. Ein gleichmäßiges Signal hat den Wert 0=5,
leichter Schwund der dennoch nicht störend wirkt hat den Wert 0=4. Wird der Empfang durch Signalschwund stark beeinträchtigt ist die Stufe 0=2 angebracht, bei 0=1 ist der Empfang völlig unbrauchbar.
O Gesamtwertung stellt praktisch eine Zusammenfassung der vorhergegangenen Kriterien dar und ist um so schlechter je schwächer der Empfang ist.
Sinnvoll ist es, bei erkannten Störungen die Störquelle mit anzugeben, d.h. ein störender Sender zu benennen oder näher zu beschreiben
Der Engländer John Harrison löste vor rund 200 Jahren die nautischen Probleme seiner Landsleute. Er erfand den Chronometer, die genau gehende Uhr. Jetzt ließ sich das von Eratosthenes 250 v. Chr. für die Seefahrt entwickelte Koordinatennetz aus Parallelkreisen und Meridianen in ein Breiten- und Längengradsystem wandeln und die 4 Minuten zu schnell tickende Sternzeit korrigieren. Alle 15 Grad beginnt nun eine neue Zeitzone, die die sogenannte wahre Ortszeit "WOZ" ablöste, die war natürlich von Ost nach West sehr unterschiedlich und mit dem beginnenden Eisenbahnzeitalter nicht mehr vereinbar. Seit 1893 gilt für Deutschland, dass genau am 15. Längengrad Ost gelegene Görlitz als Maßstab der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ). So beschlossen es die Gesetzgeber am 12. März 1893. Dass später noch die Sommerzeit hinzu kam, ändert nichts an der Zonenzeit, so der offizielle Begriff.
Die Weltzeit oder Universal Time (UT) wurde 1926 als Ersatz für die Greenwich Mean Time (GMT) eingeführt. Sie wurde aus astronomischen Beobachtungen gewonnen und entspricht etwa der mittleren Sonnenzeit am Meridian durch Greenwich (Grossbritannien - Längengrad 0). Ältere Programme und Informationen enthalten immer noch Angaben in GMT. Dafür kann man in der Regel die neuere Bezeichnung UTC einsetzen bzw. die entsprechende Zeitangabe in UTC übernehmen. Für die meisten astronomischen Berechnungen wird UT1 benutzt - eine präzise berechnete Form von UTC . Jedoch ist die Dauer der aus UT1 abgeleiteten Sekunde schwankend, weil die Erdrotation unregelmäßig verläuft. Daher wurde mit der Coordinated Universal Time (UTC) (Koordinierte Weltzeit) eine neue Zeitskala definiert.
Koordinierte Weltzeit (UTC)
Deren Zeiteinheit ist die SI-Sekunde -- realisiert durch Atomuhren. UTC bietet sowohl eine hochkonstante Zeiteinheit als auch Übereinstimmung mit dem Sonnenlauf. Aus diesem Grunde ist UTC heute die einheitliche Grundlage für die Zeitbestimmung im täglichen Leben. Sie wird über Zeitsender und andere Zeitdienste öffentlich verbreitet. Die UTC ist somit auch eine Grundlage von Zeitangaben geworden, welche international verwendet werden (Radiosender, die über Satellit oder Kurzwelle ausstrahlen benutzen meist UTC-Angaben, wie auch Amateurfunker). Der Hörer in den einzelnen Ländern muss nur wissen, wie sich seine lokale Zeit zur UTC verhält. In Deutschland haben wir UTC plus 1 Stunde - wenn es also 13:00 Uhr UTC ist, dann ist es in Deutschland
14:00 Uhr. Während der Sommerzeit müssen wir zwei Stunden zur UTC-Angabe dazuzählen.
Was wäre ohne Weltzeit?
Ohne genaue Kenntnis der jeweiligen Ortszeiten wäre wohl kaum eine Verabredung möglich. Wer wüsste denn, wann ein Flugzeug in Brasilien landet, wenn es um 16 Uhr Sommerzeit hier losfliegt und genau 10 Stunden Flugzeit braucht? Ein Chat am Sonntag im Internet um 17 Uhr - kein Problem - nur hat Aki in Tokio wahrscheinlich gerade Mitternachtsträume zu diesem Zeitpunkt und wird vergeblich um 11 Uhr unserer Zeit gewartet haben.
Klicke auf die Weltkarte und Du kannst sehen wie spät es in anderen Ländern ist
Achtung: Tag und Nachtdarstellung ist leider nicht möglich
zurück zur Startseite Sitemap Suchmaschine Links
Mein Hobby Rundfunk aus 5 Erdteilen QSL - Karten aus aller Welt Meine Logs
Hobby-Abkürzungen RKI - Emailhörerclub RKI - QSL - Karten Wetter und Devisen
koreanische Kultur in Deutschland Literatur Kochecke Kalender Downloads
KNTO - Reiseangebot Reiseberichte Geschichte Koreas Traditionelle koreanische Tänze
Pansori koreanische Musikinstrumente Bildungswesen in Korea
Chongmyo - Zeremonie Kurzbiografie